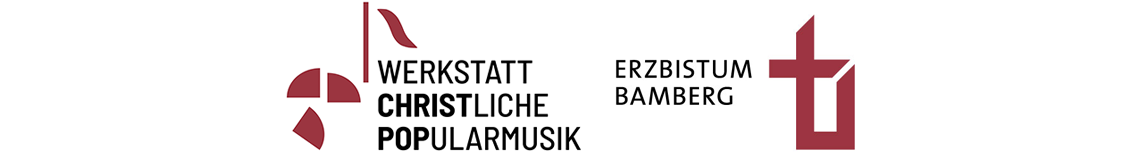Das sog. Neue Geistliche Lied im Gottesdienst aus katholischer Sicht – subjektive Eindrücke des Diözesanreferenten der Erzdiözese Bamberg
(Artikel für Music und Message 07-2002)
Spätestens seitdem das II. Vatikanische Konzil vor inzwischen schon 37 Jahren die Gemeinschaft der Gläubigen als handelndes Subjekt in der Liturgie definiert hat und den gottesdienstlichen Gesang als „notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie“ (SC 112) erkannt hat, wurden, wenn auch oft heftig umstritten, in der katholischen Kirche die Türen geöffnet für neue muttersprachliche Gesänge, die auch die Musikstile der Zeit (damals v.a. Gospel und Jazz) aufgriffen. Auch in einer Stellungnahme der römischen Gottesdienstkongregation aus dem Jahr 1970 (3. Instruktion zur Liturgiekonstitution) wird dies grundsätzlich gestattet, wenn auch mit der Einschränkung, dass die Kirchenmusik die „Aufmerksamkeit wie innere Teilnahme auf das heilige Geschehen“ zu lenken habe. Die „innere Einstellung der Gemeinde“ könne dabei darüber befinden, welche Instrumente dafür geeignet seien, dich wird die Forderung nachgeschoben, dass die Instrumente „die Frömmigkeit fördern und nicht zu viel Lärm verursachen“ sollen. Ziel jeder Kirchenmusik müsse dabei laut Konzil sein, das „Gebet inniger zum Ausdruck“ zu bringen als ein gesprochener Text, die „Einmütigkeit“ zu fördern bzw. die liturgische Handlung „mit größerer Feierlichkeit“ zu umgeben. Und 1973 spricht schließlich Papst Paul VI. von einem „neuen musikalischen Fortschritt“, „um der Kirche von heute und morgen eine lebendige und zeitgemäße Kirchenmusik zu sichern“.
Warum nun der Exkurs in die jüngere Kirchengeschichte? Vielerorts prägen (gerade auf dem Land) tatsächlich immer wieder noch solche grundsätzlichen Fragen die Situation im Gottesdienst (und der Pfarrer bestimmt dabei, was der Liturgie zuträglich ist und was nicht). Vielerorts hat man aber freilich sofort erkannt, wie wichtig es ist, dass sich die feiernde Gemeinde in ihrer Pluralität, also auch und gerade die Jugendlichen - die Zukunft der Kirche -, in Texten und Liedern, die ihre Alltagsfreuden und –sorgen verarbeiten, wiederfinden können. Und so hat man ihre Bedürfnisse ernst genommen und ihnen auch offiziell neben ersten Ansätzen neueren Liedguts im Gesangbuch „Gotteslob“ aus dem Jahr 1975 in den meisten Diözesananhängen zu diesem Liederbuch für den Gottesdienst Raum gegeben. Dass es allerdings noch nicht selbstverständlich ist, sog. Neues Geistliches Lied (NGL) im Kirchengesangbuch wiederzugeben, zeigen die ersten Vorbereitungen für ein eben beschlossenes neues Gesangbuch (realistischerweise: in etwa 10 Jahren wird es erscheinen), in die bisher kein Vertreter der „NGL-Szene“ einbezogen wurde. Allerdings: Die oft beschworene „Unvereinbarkeit“ zwischen traditioneller Kirchenmusik und NGL ist inzwischen überall einem versöhnlichem Miteinander gewichen und in vielen Diözesen gibt es schon einen eigenen NGL-Referenten. Man hat akzeptiert, voneinander zu lernen! Nur: unter Umständen wird das gerade im Ungewöhnlichen, oft geradezu Rebellischen reizvolle NGL dadurch auch domestiziert, unterscheidet sich schließlich kaum mehr von einem moderneren traditionellen Kichenlied (wie in der französischen katholischen NGL-Bewegung).
Was ist aber denn nun überhaupt „NGL“ - und wie wird es gepflegt? In der katholischen „Szene“ hat sich bewusst dieser sehr offene Begriff eingebürgert, weil man unter diesem Dach verschiedenen Stilen Heimat geben kann – von Jazz; Gospel und Sacro-Pop (v.a. der ’70er und 80er Jahre, erneuert durch die aufwändig, aber meist sehr „soft“ arrangierten Lieder der ’90er) über Rap, HipHop und Techno bis hin zu Ethno-Klängen aus aller Welt und meditativen Gesängen (aus Taizé z.B.)! Und diese Pluralität hat auch in den Gottesdienst Eingang gefunden – durch Laien (inzwischen schon in der 2. oder gar 3. Generation), die eigene Bands, Musizierkreise und Chöre gründen und so den Gottesdienst der Gesamtgemeinde bereichern (oft aber auch an der Musik ihrer eigenen Jugend festhalten, anstatt progressiv vorauszuschauen); dabei hat sich in den meisten Gemeinden ein fester Stamm von durch diese engagierten Musiker und Sänger eingeführten Liedern etabliert. Manche Gruppe (oder ihr Leiter) schreiben auch selbst neue Lieder, die meist am Grad ihrer Singbarkeit in der Gemeinde gemessen werden. Die Förderung der aktiven Beteiligung möglichst vieler Gemeindemitglieder (gerade auch der Jüngeren, die meist nur schwer überhaupt einen Zugang zu Gemeinde und Gottesdienst finden können und wollen) an „ihrer“ Musik im Gottesdienst und der Anstoß zur Schaffung neuen Liedguts (wie derzeit im Liederwettbewerb „Gottesbegegnungen“ der Erzdiözese Bamberg) ist daher auch vorrangiges Ziel von Angeboten der NGL-Arbeitskreise der Diözesen. Eine breite stilistische Palette schafft hierfür größere Identifikationsmöglichkeiten. Es geht also nicht um Konsum von Musik, sondern um eigene kreative Produktivität eines breiten Adressatenkreises (natürlich mit gelegentlichen Abstrichen in der Qualität von Arrangement und Ausführung). Die in der evangelischen „Szene“ weithin bekannten professionellen Ensembles (bis hin zum Starkult von „No Generation“) sind katholischerseits selten im Blick – und eine Tradition von Konzertveranstaltungen und sonstigen „Events“ mit NGL gibt es kaum. Neben dem Gemeindegottesdienst entstehen aber vereinzelt auch experimentelle Formen wie Jugendgottesdienste mit Techno-Elementen im Dekanat Lohr am Main oder die Aktion „LitFass“ (Liturgie mit Aktionen zum Mitmachen, zum „Anfassen“) eines kath. Jugendverbandes (KJG) in der Diözese Würzburg oder die Entdeckung nächtlicher Gebetsstunden (in Anlehnung an das klösterliche Stundengebet) mit meditativer Musik (wie die „Nachtwandler“-Programme des schwäbischen Ensembles „Entzücklika“) - oft auch unter besonderer Einbeziehung des Kirchenraumes mit Lichteffekten und Raumchoreographie -, oder die Verbindung von weltkirchlichem Engagement im sozialen Bereich und der Einbeziehung liturgischer Formen (z.B. nach dem Messritus aus Zaire) und musikalischer Traditionen dieser Länder (wie in der Nürnberger Pfarrei St. Marien, wo afrikanische Gottesdienstmusik mit Marimbas, Percussion, Gesang und Tanz mit Gastmusikern und dem ortsansässigen Kirchenchor das spirituelle Leben neu „in Schwung bringt“) oder ... .
Die Entdeckung dieser neuen Möglichkeiten gibt Anlass zur Hoffnung, dass das NGL auch in unseren Tagen immer wieder neu frischen Geist in die Kirche bringen kann und wird.
Nürnberg, 15. Juli 2002
NGL-Diözesanreferent Bernd Hackl, Nürnberg/Bamberg